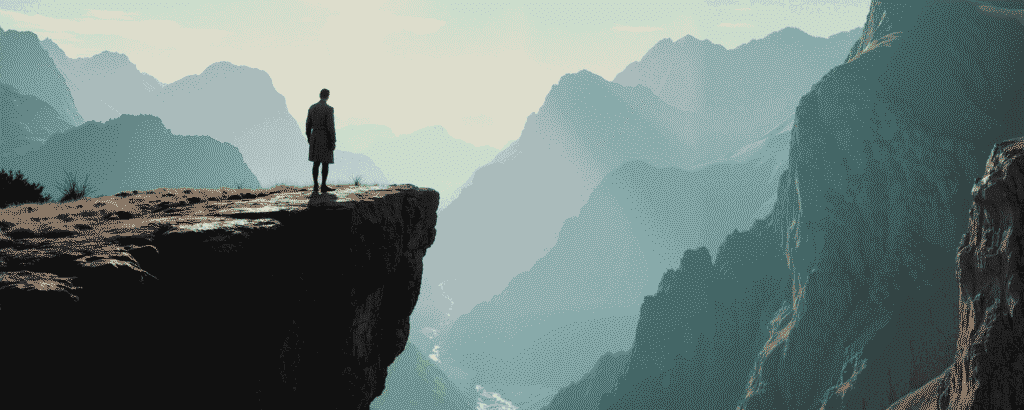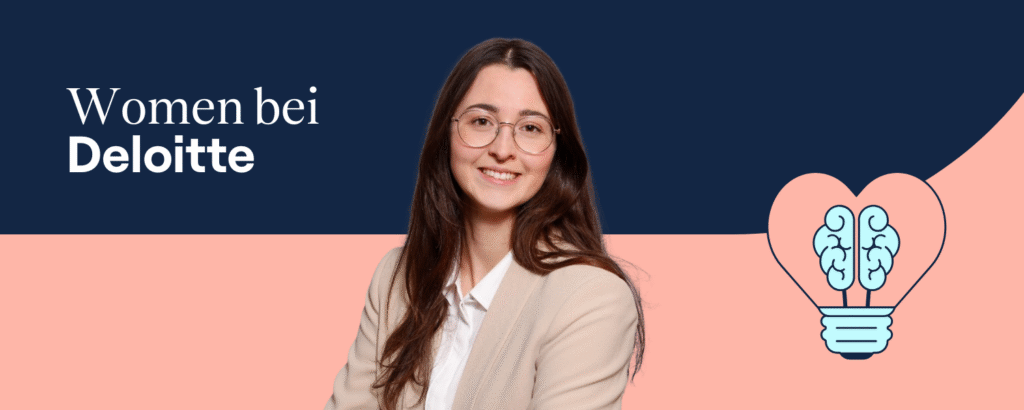Kennst du das Gefühl, plötzlich an deinem Platz zu zweifeln, obwohl du objektiv erfolgreich bist? Vielleicht hast du gerade deinen Einstieg ins Consulting geschafft, beispielsweise bei Kearney, Deloitte, McKinsey oder Roland Berger. Du bereitest Präsentationen für Führungskräfte der C-Level-Ebene vor, baust als erfahrener Financial Consultant neue Modelle oder arbeitest als Teamleiter an anspruchsvollen Projekten. Von außen wirkt dein Auftreten souverän. Doch innerlich fragst du dich, wann auffliegt, dass du „eigentlich nichts kannst“. Willkommen im Imposter-Syndrom, einem Phänomen, das in der Beraterwelt erstaunlich viele betrifft.
Das Imposter-Syndrom betrifft besonders ambitionierte Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen und ihre Erfolge nicht als Ergebnis eigener Leistung wahrnehmen. In diesem Beitrag erfährst du, was hinter dem Syndrom steckt, woran du es erkennst, wie du lernst, den eigenen Erfolg auch wirklich anzunehmen und wie es sich vom Muster des Insecure Overachievers unterscheidet.
Was ist das Imposter-Syndrom?
Das Imposter-Syndrom beschreibt das ständige Gefühl, den eigenen Erfolg nicht verdient zu haben, als hätte man sich nur „durchgeschummelt“. Es tritt besonders häufig im beruflichen Umfeld auf, gerade bei leistungsstarken und engagierten Menschen.
Typisch ist: Du hast gute Ergebnisse erzielt, vielleicht sogar Lob von Partner:innen oder Kund:innen erhalten und trotzdem glaubst du, dass es nur Glück war. Betroffene können ihre eigene Leistung kaum realistisch einschätzen. Sie vergleichen sich ständig mit anderen, die vermeintlich „kompetenter“ sind, und haben Angst, eines Tages als „Hochstapler:in“ entlarvt zu werden.
Im Consulting zeigt sich das Imposter-Syndrom besonders stark: hohe Taktung, komplexe Projekte, ambitionierte Kolleg:innen und ein Umfeld, in dem Perfektion oft stillschweigend erwartet wird. Wer hier neu einsteigt, empfindet schnell das Gefühl, nicht Schritt halten zu können. In der ersten Folge des neuen Podcasts „TBH by BCG“ tauschen sich dazu auch Tiffany Kaufmann (Consultant) und Lukas Haider (Managing Director und Senior Partner) von BCG zu dem hochaktuellen Thema des Imposter-Syndroms aus und teilen ihre persönlichen Erfahrungen.
Insider-Perspektive: Tiffany Kaufmann (Consultant bei BCG) vermutet:
„Ich glaube, mit dem Job als Beraterin gehört es einfach dazu, dass man sich immer wieder die Frage stellt, ist man eigentlich am richtigen Ort und kann man das überhaupt, was von einem erwartet wird.“
Wer hat das Imposter-Syndrom entdeckt?
Das Imposter-Syndrom ist kein neues Phänomen, auch wenn es heute häufiger diskutiert wird als je zuvor. Der Begriff tauchte erstmals 1978 in der Forschung auf. Die Psychologinnen Pauline Rose Clance und Suzanne Imes von der Georgia State University beschäftigten sich damals mit erfolgreichen Frauen, die trotz beeindruckender Leistungen massive Selbstzweifel hatten.
Bei ihren Untersuchungen stellten sie fest, dass viele Betroffene ihren Erfolg nicht sich selbst zuschrieben, sondern äußeren Umständen wie Glück oder Zufall. Um dieses Gefühl messbar zu machen, entwickelten Clance und Imes später den sogenannten Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS). Dieser Fragebogen wird bis heute genutzt, um das Ausmaß des Hochstapler-Gefühls einzuordnen.
Was sind typische Symptome des Imposter-Syndroms?
Das Imposter-Syndrom hat viele Gesichter. Oft beginnt es schleichend – als leichte Selbstkritik, die sich mit der Zeit zu chronischen Selbstzweifeln auswächst.
Typische Anzeichen sind:
- Ein permanentes Gefühl der Unzulänglichkeit: Egal, wie viel du bereits erreicht hast, es fühlt sich nie genug an.
- Selbstzweifel trotz Erfolg: Du fragst dich immer wieder, ob du wirklich gut genug bist.
- Erfolge gelten als Zufall: Wenn ein Projekt gut läuft, schreibst du es äußeren Umständen oder Glück zu.
- Misserfolge wiegen schwerer: Jeder kleine Fehler scheint den inneren Verdacht zu bestätigen, dass du nicht geeignet bist.
- Angst, enttarnt zu werden: Du glaubst, dein Umfeld überschätzt dich und dass irgendwann auffällt, dass du „nicht dazugehörst“.
- Lob kommt nicht an: Selbst positives Feedback verändert dein Selbstbild kaum.
- Überarbeitung: Viele Betroffene kompensieren ihre Zweifel durch exzessives Arbeiten, bis hin zu extremer Erschöpfung oder Burnout.
Gibt es Berufsfelder, in denen das Imposter-Syndrom häufiger auftritt?
Das Imposter-Syndrom ist in vielen Branchen verbreitet. Medizin, IT, Wissenschaft und die Tech-Szene gehören beispielsweise zu den Bereichen, in denen es besonders sichtbar wird. Häufig begegnet man dem Mechanismus jedoch auch im Beratungsumfeld. Die Dynamik der Strategieberatung und des Management Consultings sorgt dafür, dass Projekte, Teams und Aufgaben sich ständig verändern.
Genau dieser Wechsel kann verunsichern. Sobald ein Projekt beendet ist, folgt schon das nächste Thema mit neuen Ansprechpartner:innen und neuen Erwartungen. Für viele ist das eine spannende Lernkurve, für andere eine dauerhafte Belastung.
Insider-Perspektive:
“Imposter gehört zum Karriereweg dazu, solange es ein gesunder Umfang ist, weil es meiner Meinung nach dazu führt, dass man bessere Ergebnisse erzielt. Man hinterfragt immer mehr und bei diesem Hinterfragen schafft man dann doch noch mal den nächsten Schritt zur Exzellenz.”
In der Beratung entsteht leicht der Eindruck, ständig beweisen zu müssen, dass man den eigenen Platz verdient hat. Du arbeitest dich in neue Themen ein, lieferst Ergebnisse und präsentierst sie vor Führungsebenen, die hohe Anforderungen haben. Außenstehende sehen häufig nur die Professionalität, die du in der Projektarbeit an den Tag legst. Innerlich bleibt trotzdem oft die leise Frage zurück: „Werde ich wirklich als kompetent wahrgenommen oder hatte ich einfach Glück?“
Tiffany Kaufmann, Consultant bei BCG
Insider-Perspektive: Arthur C. Brooks (Management-Professor an der Harvard Business School) denkt, dass Selbstzweifel auch ein gutes Zeichen sein können, denn nur bei echten Hochstaplern treten diese nicht auf. Er sagt:
„Die Wahrheit ist: Wenn du dich wirklich gut in deiner Karriere entwickelst und dafür belohnt wirst, und wenn du eine normale, gesunde Person bist, dann wirst du dich irgendwann fragen: Habe ich das verdient?“
Wo liegen die Ursachen für das Imposter-Syndrom?
Bis heute gibt es keine einzige Erklärung, die alle Facetten des Imposter-Syndroms vollständig beschreibt. Klar ist jedoch: Es taucht fast immer in Leistungskontexten auf, daher besonders häufig im beruflichen Umfeld. Das erklärt auch, warum viele Absolvent:innen und junge Berater:innen in Consulting-Firmen anfällig dafür sind.
Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie Perfektionismus oder ein Hang zu starkem Grübeln können ebenfalls eine Rolle spielen. Auch das Umfeld prägt das eigene Selbstbild. Wenn Eltern die Leistung stark betonen oder hohe Erwartungen setzen, entsteht schon im Kindesalter das Gefühl, immer noch ein Stück besser sein zu müssen. Auch widersprüchliche Rückmeldungen, mal Lob, mal Kritik bei ähnlicher Leistung, erschweren es Kindern später, ihre eigene Leistung realistisch einzuschätzen.
Das Imposter-Syndrom hat also viele mögliche Wurzeln. Was sie verbindet: Die Angst davor, anderen nicht gerecht zu werden.
Gibt es Personen, die anfälliger für das Imposter-Syndrom sind?
Lange hielt sich die Annahme, dass vor allem Frauen vom Imposter-Syndrom betroffen seien. Heute weiß man: Männer erleben diese Selbstzweifel genauso häufig. Sie sprechen nur seltener darüber.
Eine Studie von KPMG zeigt, wie weitverbreitet diese Selbstzweifel-Spirale ist: Bis zu 75 Prozent der befragten weiblichen Führungskräfte berichteten, im Laufe ihrer Karriere Phasen gehabt zu haben, in denen sie sich wie Hochstaplerinnen fühlten. Das verdeutlicht, wie sehr selbst erfolgreiche Menschen unter dem ständigen inneren Druck leiden können.
Grundsätzlich kann jeder betroffen sein, vom Berufseinstieg bis zur erfahrenen Führungskraft. Das Imposter-Syndrom unterscheidet nicht zwischen Branchen oder Hierarchiestufen.
Insider-Perspektive: Lukas Haider (Managing Director & Senior Partner bei BCG) blickt zurück:
„Gerade vor etwa 20 Jahren habe ich mich sehr häufig wie ein Imposter gefühlt – bis hin zu der Frage, ob ich überhaupt richtig bin. Gleichzeitig begegne ich auch heute im Alltag immer wieder Momenten, in denen ich denke: Hoppla, in welche Situation bin ich da geraten, wie passt das alles zusammen? Ich glaube, das ist ein wiederkehrendes Thema.“
Welche Auswirkungen kann das Imposter-Syndrom haben?
Wenn das Gefühl, nicht gut genug zu sein, dauerhaft bleibt, kann es das gesamte Berufs- und Privatleben beeinflussen.
Typische Auswirkungen sind beispielsweise:
- sinkende Arbeitszufriedenheit,
- nachlassende Leistungsfähigkeit, weil die Angst vor Fehlern blockiert,
- erhöhtes Burnout-Risiko durch ständigen Überarbeitungsdruck,
- verstärkte Angstgefühle oder depressive Symptome,
- weniger Zeit für Hobbys, Freundschaften, Beziehungen oder Familie
- oder gedankliches „Nachhallen“ der Arbeit bis spät in den Abend.
Viele Betroffene versuchen, Unsicherheit durch noch mehr Einsatz zu kompensieren. Doch je stärker sie sich anstrengen, desto weniger fühlen sie sich ihrer Rolle gewachsen. Ein typischer Kreislauf des Imposter-Syndroms.
Wie kann ich das Imposter-Syndrom bewältigen?
Auch wenn es sich manchmal überwältigend anfühlt, gibt es viele Wege, besser mit dem Imposter-Syndrom umzugehen. Kleine Schritte können schon helfen.
Das kannst du konkret tun:
- Sprich offen mit Menschen, denen du vertraust.
- Verzichte bewusst darauf, dich ständig mit anderen zu vergleichen.
- Halte vergangene Erfolge schriftlich fest, zum Beispiel in einer Notiz-App oder in einem Journal.
- Teile deine Erfolge auch mit anderen, statt sie herunterzuspielen.
- Übe, Lob anzunehmen. Das gilt auch für Mitarbeitergespräche, in denen dir gespiegelt wird, wie positiv deine Leistung wahrgenommen wird.
- Setze dir erreichbare Ziele und erlaube dir Fehler.
- Kümmere dich um Selbstfürsorge und ausreichend Pausen.
- Bau dir ein unterstützendes Umfeld aus Freund:innen, Familie oder Kolleg:innen.
Insider-Perspektive: Lukas Haider (Managing Director & Senior Partner bei BCG) weiß, wie man mit Unsicherheiten umgehen kann:
“Das ist ein natürlicher Prozess, der sich über die Zeit entwickelt. Vieles hat mit Erfahrung zu tun und damit, wie du lernst, mit Situationen umzugehen, die dir noch unbekannt sind – in denen du sozusagen in unerkundete Gewässer vordringst. Mit der Zeit bekommst du sowohl explizites als auch implizites Feedback, das dir zeigt, dass das funktioniert, was du tust. Das ist, glaube ich, für jeden am Anfang ein wichtiger Teil des Aufbaus des eigenen beruflichen Selbstbewusstseins. Feedback, Mentoring und andere Einflüsse spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Das bedeutet aber nicht, dass die Frage ‚Bin ich nicht trotzdem noch unsicher?‘ nicht weiterhin auftaucht.”
Wenn du an einen Punkt kommst, an dem du allein nicht weiterweißt, ist es vollkommen in Ordnung, dir Hilfe zu holen. Ein Mentoring oder Coaching kann dir neue Perspektiven geben und dir helfen, an deinen Denkmustern zu arbeiten. Werden die Selbstzweifel stärker oder belasten sie deinen Alltag, kann auch eine Therapie ein guter Weg sein.
Wie unterscheidet sich der Insecure Overachiever von Personen, die an dem Imposter-Syndrom leiden?
Der Insecure Overachiever arbeitet permanent auf Hochtouren, weil er überzeugt ist, sich seinen Platz immer wieder neu erkämpfen zu müssen. Das Imposter-Syndrom funktioniert genau andersherum: Trotz sichtbarer Erfolge fühlt man sich wie ein Hochstapler, der zufällig ins System gerutscht ist und jeden Moment auffliegt. Beide Muster begegnen einem im Consulting besonders häufig, nur zeigen sie sich auf völlig unterschiedliche Weise.
Wo sind Insecure Overachiever besonders oft zu finden?
Insecure Overachiever – auch Insecure Overperformer genannt – gibt es über alle Branchen hinweg. Und doch sind sie in der Unternehmensberatung besonders oft vertreten: Denn hier sind die Ansprüche (von außen und Top-Einsteiger:innen selbst) häufig extrem hoch, es werden steile Lernkurven in Aussicht gestellt und erwartet. Wer hier mit großen Ambitionen einsteigt und dann Aufgaben übernimmt, die bislang unbekannt waren – der fällt schnell in das Muster eines Insecure Overachievers. Übersetzen kann man diesen Persönlichkeitstypen mit „unsichere:n Höchstleister:innen“. Es handelt sich um Menschen, die viel draufhaben, die sich aber nur sicher fühlen, wenn andere Personen bestätigen, dass die eigene Leistung wirklich ausreicht.
Insider-Perspektive: Maximilian Hornschuch (National Manager des JCNETWORK) kann nachvollziehen, warum jemand aus Unsicherheit heraus besonders viel geben möchte:
„Ich kann mir vorstellen, in manchen Situationen ähnlich zu handeln – gerade, weil ich es essenziell finde, am Anfang viel zu leisten. Der Lebenslauf ist im Vergleich zu erfahreneren Kolleg:innen noch wenig gefüllt und auch unter Gleichaltrigen ist der Wettbewerb hoch. Trotzdem ist mir wichtig, neben dem Ehrgeiz auch ein gesundes Verhältnis zwischen Karriere und Freizeit zu entwickeln.“
Wer ins Consulting einsteigt und einen Mentor oder eine Mentorin an die Seite gestellt bekommt oder Manager:innen unterstellt ist, zu denen man selbst aufblickt, wird vermutlich um die Anerkennung dieser Personen kämpfen. Der tägliche Anspruch ist: overperformen und overachieven, um keinen Anlass für negatives Feedback zu geben.“
Insider-Perspektive: Jonathan Marquardt (Team Lead Key Account Management bei JCNETWORK) hat eine Vermutung, woher es kommt, wenn man selbst zum Insecure Overachiever wird:
„Dahinter stecken neben Overperformance auch Selbstzweifel und eine starke externe Orientierung nach Bestätigung. Obwohl das keinem klaren psychologischen Konzept entspricht, kann man damit gut Verhaltensmuster beschreiben, mit denen sich wahrscheinlich viele identifizieren können. Klar, ich mache mir viel Stress in der Uni gut zu performen, und natürlich hat jeder Unsicherheiten. Ich glaube aber nicht, dass ich mir diesen Druck aus Selbstzweifeln mache. Der kommt eher von Selbstreflexion und hoher Ziel-Orientierung.“
Wie erkenne ich, ob ich ein Insecure Overachiever bin?
Wer vor lauter Unsicherheit und Leistungsdrang Gefahr läuft, irgendwann auszubrennen, sollte also vorher selbst einen Gang herunterschalten. Wichtig ist dabei im ersten Schritt zu erkennen, dass man selbst zu den „Insecure Overachievern“ zählt. Karriereberaterin und Coach Ragnhild Struss schreibt auf der Website ihres Unternehmens „Struss & Claussen“ viele Beiträge zu diesem Thema und hat, um zu erkennen, ob man ein „Insecure Overachiever“ ist, die folgenden Merkmale veröffentlicht:
- Du erreichst deine Ziele, aber du fühlst dich nie wirklich angekommen.
- Du verknüpfst deinen Selbstwert überproportional stark mit deiner Leistung.
- Du funktionierst auch, wenn du längst erschöpft bist.
- Du empfindest Entspannung als unangenehm oder sinnlos.
- Du arbeitest nicht nur viel, du denkst auch ständig über die Arbeit nach.
- Du brauchst Anerkennung und zweifelst trotzdem an dir.
- Du vermeidest emotionale Tiefe aus Angst, dich zu verlieren.
- Du sabotierst dich manchmal selbst, obwohl du funktional bist.
- Du fühlst dich für alles verantwortlich, auch wenn es nicht deine Aufgabe ist.
- Du spürst, dass es leichter sein müsste, aber du traust dich nicht, langsamer zu werden.
SQUEAKER Consulting-Magazin
Fazit: Du bist besser, als dein Kopf dir einreden will
Das Imposter-Syndrom und der „Insecure Overachiever“-Modus gehören für viele Talente im Consulting zum Alltag. Beides muss dich aber nicht ausbremsen. Je besser du deine Muster erkennst, desto leichter kannst du sie einordnen und durchbrechen. Mach dir bewusst, was du bereits erreicht hast, akzeptiere Anerkennung und setz dir Ziele, die realistisch zu deinem Weg passen.

Jenny ist Senior Content Marketing Managerin und entwickelt seit der Gründung von SQUEAKER Inhalte, die Talente und Beratungen zusammenbringen, Transparenz schaffen und authentische Einblicke ermöglichen. Ihr Fokus: Themen so aufbereiten, dass Kandidat:innen echten Mehrwert erhalten und fundierte Karriereentscheidungen treffen.